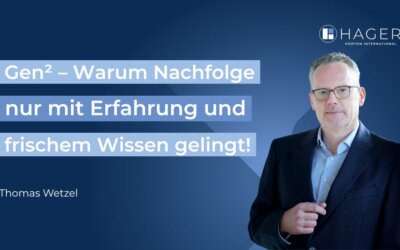Investor Insights | Beyond Capital
Der teuerste Fehler im Private Equity: Digitalisierung wie ein IT-Projekt zu behandeln
Private Equity verliert nicht an Wert, weil Technologie fehlt — sondern weil Digitalisierung immer noch wie ein IT-Upgrade behandelt wird, statt als Führungsaufgabe. Dieser Denkfehler fällt in den frühen Phasen einer Beteiligung selten auf, frisst jedoch über den gesamten Holding-Zeitraum hinweg stille Rendite. Die Lücke zwischen „über Digitalisierung sprechen“ und „Digitalisierung führen“ entwickelt sich zu einer der kostspieligsten Blindstellen der Branche.

Die größte Blindstelle im Private Equity: Technologie wird als Kostenfaktor, nicht als Strategie betrachtet
Alle sprechen im Private Equity über Digitalisierung.
Alle nennen sie unverzichtbar.
Alle schreiben sie in die Value-Creation-Pläne.
Doch bei genauerem Blick wird Technologie häufig auf eine Liste einzelner Projekte reduziert: eine ERP-Erneuerung, ein neues Dashboard, einige Automatisierungsinitiativen — vielleicht sogar ein KI-Pilot, um den Zeitgeist zu treffen.
Die unbequeme Wahrheit lautet: Unternehmen fallen selten zurück, weil ihnen Technologie fehlt. Sie fallen zurück, weil Führung Digitalisierung noch immer als IT-Projekt behandelt — statt als grundlegende Transformation der Art und Weise, wie ein Unternehmen arbeitet, entscheidet und konkurriert. Solange Digitalisierung im IT-Silo sitzt, bewegt sich der Rest des Unternehmens stets langsamer, als es der Markt verlangt.
Bei HAGER ist Digitalisierung kein Randthema. Sie ist verankert in unserem Führungsverständnis, unseren Organisationsbewertungen und unserem Transformationsansatz. Jahrzehnte der Arbeit mit Investoren, Gründern und technologiegetriebenen Unternehmen haben uns eines gezeigt: Digitale Transformation scheitert oder gelingt durch Führung — nicht durch Tools.
Technologie schafft keinen Wert — Führung tut es
Nach über 30 Jahren Beratung von Investoren und Portfoliounternehmen haben wir die gesamte Bandbreite gescheiterter Digitalisierungsinitiativen gesehen: Transformationsprogramme, die schon vor der Umsetzung steckenbleiben; KI-Piloten, die nie in den Alltag übergehen, weil die Datenbasis unzuverlässig ist; Automatisierungsroadmaps, die nicht an der Technik, sondern an der Kultur scheitern.
In all diesen Fällen zeigt sich ein Muster klar und eindeutig: Technologie ist fast nie der Engpass. Das Unternehmen dahinter ist es.
Digitalisierung scheitert, wenn Entscheidungen zu langsam getroffen werden, Datenqualität nicht durchgängig ist, Verantwortlichkeiten verstreut sind oder Führung unterschätzt, wie viel organisatorische Klarheit und kulturelle Reife echte Transformation erfordert.
KI beschleunigt Erkenntnis.
Automatisierung beschleunigt Ausführung.
Aber Führung entscheidet, ob die Organisation Beschleunigung überhaupt verkraften kann.
Die harte Realität: Digitale Unreife ist ein Bewertungsrisiko
Digitale Schwäche wird oft als operatives Problem dargestellt. In Wahrheit ist sie ein Bewertungsproblem. Ein Unternehmen ohne integrierte Systeme, gemeinsame Datenarchitektur, Automatisierungskompetenz, skalierbare Infrastruktur oder KI-Readiness ist nicht einfach ineffizient — es ist strukturell langsam und strategisch limitiert.
In der heutigen Marktumgebung ist operative Exzellenz zu Alpha geworden. Digitale Reife zu ignorieren ist nicht konservativ — es ist fahrlässig. Investoren, die Digitalisierung als Nebenthema behandeln, übernehmen Unternehmen, die nicht in dem Tempo skalieren können, das ihre Strategie erfordert.
Digital Due Diligence ist veraltet — und muss sich weiterentwickeln
Traditionelle digitale Due Diligence konzentriert sich meist auf die falschen Fragen:
Welche Systeme sind installiert?
Wie modern ist die Tech-Stack?
Welche Tools sind veraltet?
Diese Fragen beschreiben den Status quo, sagen aber nichts über die Transformationsfähigkeit eines Unternehmens aus.
Die wirklich relevanten Fragen lauten:
- Kann das Führungsteam technologiegetriebene Entscheidungen treffen?
- Unterstützt die Kultur Transparenz und Automatisierung?
- Werden Daten als strategische Assets behandelt — nicht als Nebenprodukt der Prozesse?
- Kann das Unternehmen KI verantwortungsvoll und wirksam integrieren?
- Und am wichtigsten: Besitzt die Organisation die Fähigkeit, digitalen Fortschritt überhaupt aufzubauen und zu halten?
Eine Tech-Stack ist keine Strategie.
Ein CIO ist keine Transformation.
Ein Dashboard ist keine Alignment-Struktur.
Solange digitale Due Diligence eine IT-Inventur bleibt, statt eine Bewertung organisatorischer Fähigkeiten, kaufen Investoren Software — aber keine Skalierbarkeit.
Transformation beginnt dort, wo sich Macht verschiebt
Organisationen widerstehen Digitalisierung nicht, weil sie komplex ist. Sie widerstehen, weil Technologie Machtstrukturen verändert.
Digitale Transparenz legt schwache Prozesse offen.
Automatisierung stellt traditionelle Rollen infrage.
Datenbasierte Entscheidungen ersetzen politische.
KI reduziert Entscheidungen, die auf Hierarchie statt Kompetenz beruhen.
Darum ist der anspruchsvollste Teil der digitalen Transformation nicht technisch — sondern politisch. Führung muss bereit sein, Verantwortlichkeiten neu zu gestalten, Zusammenarbeit zu definieren und Anreizsysteme neu auszurichten. Ohne diese Veränderungen bleiben selbst fortschrittlichste Technologien ungenutztes Potenzial.
Der kulturelle Preis des Nicht-Transformierens
Jedes Unternehmen zahlt eine stille Steuer, wenn es Digitalisierung hinauszögert.
Sie zeigt sich in manuellen Umwegen, veralteten Prozessen, intransparentem Reporting, langsameren Entscheidungen, steigenden Kosten und kultureller Ermüdung. Diese Steuer taucht nie in der GuV auf — aber sie frisst kontinuierlich Unternehmenswert.
Digitalisierung bedeutet nicht, Tools einzuführen.
Sie bedeutet, eine Organisation zu bauen, die schneller lernt, als sie kaputtgeht — und das erfordert Führung weit mehr als Technologie.
Was die besten Investoren anders machen
Die erfolgreichsten Investoren wissen, dass digitale Performance weit vor Technologie beginnt. Sie beginnt bei Führung, Struktur und Kultur. Sie fragen, wer die Fähigkeit hat, Transformation zu treiben. Sie schaffen Alignment, bevor sie neue Systeme einführen. Sie etablieren Governance, die Umsetzung beschleunigt.
Und sie bauen Datenkultur — nicht nur Datenplattformen.
Sie integrieren KI in Entscheidungen — nicht nur in isolierte Workflows.
Bei HAGER ist Digital & Technology nicht nur ein Sektor. Es ist unser Heimatfeld, an der Schnittstelle zwischen Marktverständnis und Führungsexpertise. Unsere Erfahrung zeigt: Digitale Führung schlägt digitale Tools — in jedem Zyklus. Die stärksten Plattformen werden nicht durch ihre Software definiert, sondern durch die Klarheit ihrer Führungsarchitektur.
Geschwindigkeit kommt von Systemen. Richtung kommt von Führung
Digitalisierung erzeugt Geschwindigkeit. Führung gibt ihr Bedeutung. Und gemeinsam schaffen sie Wettbewerbsvorteile. Geschwindigkeit mag aus Systemen kommen — aber Richtung kommt immer aus Führung. Und genau in dieser Spannung entsteht der entscheidende Moment der Wertschöpfung.
Wie Martin Krill sagt:
„Software kann man in Monaten austauschen. Aber die Kosten schwacher Führung kann man nicht ersetzen. Die meisten ‚digitalen Fehlschläge‘ sind nicht technisch — sie sind ein Mangel an Mut, Klarheit und Verantwortlichkeit.“
— Martin Krill, CEO, HAGER Executive Consulting
Genau an dieser Schnittstelle — wo Systeme beschleunigen und Führung ausrichtet — hört Digitalisierung auf, Kostenstelle zu sein, und wird zum echten Werttreiber.
Fazit: Technologie ist kein Differenzierungsmerkmal. Führung ist es.
In einem Markt voller Kapital und frei verfügbarer Technologien liegt der wahre Wettbewerbsvorteil nicht mehr im Toolset — sondern in der Organisation, die weiß, wie man es nutzt.
Denn im Private Equity wie in der Führung gilt:
Technologie kaufen ist einfach.
Sie umzusetzen ist schwierig.
Mit ihr zu skalieren ist transformativ.
Und die Unternehmen, die das verstehen, werden den Markt nicht nur übertreffen —
sie werden den nächsten definieren.